Who was Who in Dornbach und Neuwaldegg
Denkmair, Elisabeth († 2008)
Eisler, Georg
Haas, Conrad (1509-1576)
Geita, Anna (1917-2007)
Geiter, Rudolf
Jäger, Helene (1922-2008)
Jarl-Sakellarios, Karin
Lacy, Franz Moritz Graf (1725-1801)
Nossberger, Anna "Nossi"
Pretschgo, Andreas
Schmidt, Friedrich von (1825-1891)
Seifert-Kuntner, Marie (1872-1950)
Singende Wirtin von Neuwaldegg
Terramare, Georg (1889-1948)
Turecek-Pemer, Emilie (1846-1889)
 Emilie
Turecek-Pemer,
vom Volksmund auch „Fiaker-Milli“ genannt,
wurde am 30. Juni 1846 in Chotibor, Böhmen, geboren und verstarb am 13. Mai
1889 in Dornbach. Die Volkssängerin war mit dem Fiaker Ludwig Demel
verheiratet. Ihre Auftritte in den Vergnügungslokalen in und um Wien riefen
stets beachtliches Aufsehen hervor. Auch wurden ihre „Wäschermädel-“ und
„Fiakerbälle“ von den Wienern gerne angenommen.
Emilie
Turecek-Pemer,
vom Volksmund auch „Fiaker-Milli“ genannt,
wurde am 30. Juni 1846 in Chotibor, Böhmen, geboren und verstarb am 13. Mai
1889 in Dornbach. Die Volkssängerin war mit dem Fiaker Ludwig Demel
verheiratet. Ihre Auftritte in den Vergnügungslokalen in und um Wien riefen
stets beachtliches Aufsehen hervor. Auch wurden ihre „Wäschermädel-“ und
„Fiakerbälle“ von den Wienern gerne angenommen.
Feldmarschall Franz Moritz Graf von Lacy (* 21. Oktober 1725 in Sankt Petersburg; † 24. November 1801 in Wien) war ein österreichischer Feldherr. Lacy (auch Lascy) wurde am 21. Oktober 1725 als Sohn Peter Graf von Lacy (* 29. September 1678; † 30. April 1751) und dessen Gattin Martha Philippine geb. von Funcken in St. Petersburg geboren.
Die Familie stammt aus normannischem Adel (Lassy (Calvados/Normandie), und ließ sich später in Irland nieder. Franz Moritz´ Vater Peter de Lacy trat 1698 in russische Dienste und begründete hier einen Zweig der Familie. 1737 verließ Franz Moritz Graf von Lacy Russland und ging zunächst nach Liegnitz, ehe er 1739 nach Wien übersiedelte.
1743 trat er in die österreichische Armee ein. Im Österreichischen Erbfolgekrieg focht er 1746 bei Piacenza und Rottofredo, und ein Jahr später auch bei Genua. 1749 wurde er zum Oberstleutnant, und 1753 zum Oberst ernannt. Am Beginn des Siebenjährigen Krieges wurde er nach der Schlacht bei Lobositz (1. Oktober 1756) zum General-Feldwachtmeister befördert. Im Jahre darauf machte er, nach der Schlacht bei Breslau (22. November 1757), den nächsten Karrieresprung als er zum Feldmarschallleutnant und Generalquartiermeister ernannt wurde. Lacy reorganisierte die österreichische Armee, von ihm stammte im Siebenjährigen Krieg der Plan für die Schlacht von Hochkirch am 14. Oktober 1758. Nach der Schlacht erhielt er auch dafür das Großkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens. Seine Karriere ging weiter steil bergauf. 1759 führte er den Plan bei Maxen (nahe Dresden) aus, den so genannten „Finckenfang von Maxen“. 17.000 Österreicher schließen ein 15.000 Mann starkes Preußisches Heer unter General Friedrich August von Finck ein. Dafür wurde er zum General-Feldzeugmeister ernannt. Am 9. Oktober 1760 greift Lacy gemeinsam mit dem russischen General von Todtleben Berlin an und besetzt es. Berlin ist damit nach 1757 zum zweiten Mal im 7-jährigen Krieg von den Österreichern besetzt. Allerdings wird die Stadt bereits am 12. Oktober vor den herannahenden Preußen wieder geräumt. 1763 wird Franz Moritz Graf von Lacy zum Hofkriegsrat, drei Jahre später zum Hofkriegsratspräsident ernannt, der er bis 1774 blieb. 1770 wird er Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, 1794 Kanzler des Militärischen-Maria-Theresien-Ordens. Im so genannten „Zwetschkenrummel“, dem Kampf um das Bayerische Erbe, unterstützte er Kaiser Joseph II., der persönlich das Oberkommando führte. Allerdings kam es durch Kriegsmüdigkeit, Geldmangel, Nachschub-Probleme etc. zu keinen nennenswerten Kämpfen. Nach Rückschlägen im Türkenkrieg von 1788/89, etwa dem Durchbruch bei Alt-Orsova am 7. August 1788 und der Schlacht bei Mehadia 28. August 1788, musste Lacy den Oberbefehl an Ernst Gideon von Laudon abgeben, mit dem er seiner vorsichtigen Taktik wegen in Konflikt geraten war. Bemerkenswert ist auch, dass Kaiser Joseph II. am Tag bevor er starb (19. Februar 1790) Lacy einen Brief schrieb in dem er ihn für seine Verdienste ausdrücklich dankte.
Franz Moritz Graf von Lacy kaufte 1765 das Gut Neuwaldegg (Wien-Hernals) in dessen Park er auch begraben liegt. Das Schloss Neuwaldegg wurde für Lacy erbaut.
Lacy ist sowohl am Wiener Maria-Theresien-Denkmal (hinter Lichtenstein im Halbrelief ganz links) als auch in der Feldherrnhalle im Wiener Arsenal dargestellt. Im Arsenal ist auch jene Büste zu bewundern, die Kaiser Joseph II. 1783 für den Hofkriegsrat fertigen ließ. Lacy ließ auch das Lustschloss Schloss Wilhelminenberg bauen. In der Gedenkstätte Heldenberg ist eine Büste von Franz Moritz Graf von Lacy aufgestellt. Franz Moritz Graf von Lacy blieb unverheiratet und hatte keine Kinder. Nachfahren des russischen Zweiges der „de Lacys“, aus dem ja auch Franz Moritz stammte - die „O'Brien de Lacys“, leben heute, nach ihrer Flucht aus dem Gut Augustówek in der Nähe von Grodno (heute Weißrussland) 1939, in Polen und Argentinien und haben nach wie vor enge Kontakte mit Österreich.
 Marie
Seifert-Kuntner (Geb. am 12.3.1872 in
Wien-Neuwaldegg, gest. 25.7.1950). Tochter eines Maurermeisters, der
Großvater restaurierte die alte Dornbacher Kirche; die Mutter Katharina
Willinger stammte aus einer der ältesten Neuwaldegger Familien. Ihr Vater
war Weinhauer und schenkte damals den sehr beliebten „Lampelwürstler“ aus,
den außer ihm nur der Pfarrer von Dornbach und der "Stalehner" (Steinlechner)
kelterten. Die in einer musikalischen Familie aufwachsende Mitzi zeigte bald
ihre stimmliche Begabung und wurde nach entsprechender Schulung eine
erfolgreiche Konzertsängerin. Ihre besondere Liebe galt aber stets dem
Wiener Dudler, dem wirklich erlebten und nicht komponierten Volksgesang, und
dem Wiener Lied. Von 1910 bis 1923 war sie an der Wiener Urania in
zahlreichen Vorträgen zu hören und unternahm auch mehrere Konzertreisen. In
den letzten 30 Jahren betrieb sie bis drei Wochen vor ihrem Tod ein stets
gut besuchtes Weinhaus in der Neuwaldegger Straße 47 und war als die
„Singende Wirtin“ bekannt. Verheiratet war sie mit dem Direktionsrat der
Stadt Wien, Franz Seifert. Der Text wurde freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von Frau Trude Neuhold, Bezirksmuseum Hernals.
Marie
Seifert-Kuntner (Geb. am 12.3.1872 in
Wien-Neuwaldegg, gest. 25.7.1950). Tochter eines Maurermeisters, der
Großvater restaurierte die alte Dornbacher Kirche; die Mutter Katharina
Willinger stammte aus einer der ältesten Neuwaldegger Familien. Ihr Vater
war Weinhauer und schenkte damals den sehr beliebten „Lampelwürstler“ aus,
den außer ihm nur der Pfarrer von Dornbach und der "Stalehner" (Steinlechner)
kelterten. Die in einer musikalischen Familie aufwachsende Mitzi zeigte bald
ihre stimmliche Begabung und wurde nach entsprechender Schulung eine
erfolgreiche Konzertsängerin. Ihre besondere Liebe galt aber stets dem
Wiener Dudler, dem wirklich erlebten und nicht komponierten Volksgesang, und
dem Wiener Lied. Von 1910 bis 1923 war sie an der Wiener Urania in
zahlreichen Vorträgen zu hören und unternahm auch mehrere Konzertreisen. In
den letzten 30 Jahren betrieb sie bis drei Wochen vor ihrem Tod ein stets
gut besuchtes Weinhaus in der Neuwaldegger Straße 47 und war als die
„Singende Wirtin“ bekannt. Verheiratet war sie mit dem Direktionsrat der
Stadt Wien, Franz Seifert. Der Text wurde freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von Frau Trude Neuhold, Bezirksmuseum Hernals.
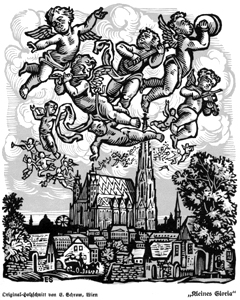 Georg
Terramare (eigentlich Georg Eisler von
Terramare; geb. 2.12.1889 Wien, gest. 4.4.1948 La
Paz (Bolivien); Erzähler, Dramatiker und Regisseur. Ab 1922 erfolgreicher
Leiter der
Wiener Laienspielschar "Wiener
Schottenspiele", dann Regisseur in Bern, Hamburg, Wien und Troppau; ging
1939 von der ČSSR über Italien ins Exil nach La Paz, Bolivien. Er wurde durch
seine Mysterienspiele ("Ein Spiel vom Tode, dem Antichrist und den letzten
Dingen", 1922; "Ein Spiel von den letzten Dingen", 1927) bekannt.
Insbesondere aber verlegte er in seiner Erzählung "Uns ward ein Kind
geboren" (1947) die christliche Weihnachtsgeschichte in entzückender Weise
nach Dornbach.
Georg
Terramare (eigentlich Georg Eisler von
Terramare; geb. 2.12.1889 Wien, gest. 4.4.1948 La
Paz (Bolivien); Erzähler, Dramatiker und Regisseur. Ab 1922 erfolgreicher
Leiter der
Wiener Laienspielschar "Wiener
Schottenspiele", dann Regisseur in Bern, Hamburg, Wien und Troppau; ging
1939 von der ČSSR über Italien ins Exil nach La Paz, Bolivien. Er wurde durch
seine Mysterienspiele ("Ein Spiel vom Tode, dem Antichrist und den letzten
Dingen", 1922; "Ein Spiel von den letzten Dingen", 1927) bekannt.
Insbesondere aber verlegte er in seiner Erzählung "Uns ward ein Kind
geboren" (1947) die christliche Weihnachtsgeschichte in entzückender Weise
nach Dornbach.
Friedrich von Schmidt (22.10.1825 - 23.1.1891), der große Dombaumeister und Erbauer des Neuen Wiener Rathauses (1885), wohnte in der so genannten "Bärenvilla" in Dornbach (Andergasse 8), einem von ihm umgestalteten Haus eines Weinbauern. Die "Bärenvilla" wurde ein beliebter Treffpunkt der Künstler und Architekten seiner Zeit. Unter ihnen wären der berühmte Ringstraßenarchitekt Theophil von Hansen und der große Maler Hans Markart zu nennen. Ebenfalls zu nennen wären auch der Bildhauer Otto Jarl, der Schwiegersohn Schmidts, und dessen Tochter Karin Jarl-Sakellarios. Von Karin Sakellarios stammen die weltweit bekannten Lipizzanerstatuen aus weißem Augartenporzellan aus der gleichnamigen Manufaktur.
Kammerschauspieler Ewald Balser (1898-1978) wohnte in der Promenadegasse 24 (Dornbach). Geboren am 5. 10. 1898 in Elberfeld bei Wuppertal (D), verstorben am 17. 4. 1978 in Wien; Ehemann von Vera Balser-Eberle. Nach Engagements in Basel und Düsseldorf war er ab 1928 Mitglied des Wiener Burgtheaters, wo er als "Faust" debütierte und zahlreiche Heldengestalten verkörperte; Gastspiele in München, Berlin und bei den Salzburger Festspielen; daneben wirkte er auch in zahlreichen Filmen mit und war auch als Regisseur tätig; zahlreiche Ehrungen, u. a. 1963 Ehrenmitgliedschaft des Wiener Burgtheaters, Träger des 1967 Grillparzer-Rings, 1968 Verleihung der Kainz-Medaille.
Conrad Haas (* 1509 in Dornbach bei Wien; †
1576 in Sibiu (= Hermannstadt), Rumänien). Conrad Haas war ein
österreichischer Millitärtechniker und Raketenpionier. 1551 kam er mit der
Armee des österreichischen Kaisers Ferdinands als Zeugwart und
Büchsenmeister nach Hermannstadt, wo er die Leitung des Kriegsarsenals
übernahm. Zwischen 1529 und 1556 verfasste er ein Kunstbuch, in dem er auf
282 Seiten die damals zwei bekannten Einsatzgebiete - Feuerwerksträger und
Waffe - der Raketentechnik beschrieb. Dieses Handschrift wurde erst 1961 im
Hermannstädter Staatsarchiv gefunden. In diesem Werk geht Haas auf
fertigungstechnische Detailfragen des Raketenbaus ein, wobei er auch das
Wirkungsprinzip der Rakete erklärt, und beschreibt eine Vielzahl von
Raketentypen, beispielsweise die Mehrstufenrakete, die Bündelrakete und die
Idee des modernen Raumschiffs. Ferner beschäftigt er sich mit der Anordnung
der Treibstoffsätze bei Stufenraketen, verschiedenen Treibstoffgemischen
inklusive Flüssigtreibstoff und führte deltaförmige Stabilisierungsflossen
und glockenförmigen Düsen ein.
Im letzten Absatz seines Werkes schreibt er: Aber mein Rath mehr
Fried und kein Krieg, die Büchsen do sein gelassen unter dem Dach, so wird
die Kugel nit verschossen, das Pulver nit verbrannt oder nass, so behielt
der Fürst sein Geld, der Büchsenmeister sein Leben; das ist der Rath so
Conrad Haas tut geben.
Anna Geita. „Ein intensiv erfülltes Leben ist zu Ende gegangen ... Es war geprägt von Liebe und Hingabe an ihre große Familie. Ihre Disziplin und ihr Einsatzwille waren beispiellos. Größte Freude bereitete ihr die Beschäftigung mit Geschichte, Musik und Fotografie. Ein brillantes Gedächtnis zeichnete sie auch noch in hohem Alter aus. Bis zum letzten Tag war sie ein treues Mitglied des Wiener Sportklubs. Ihre Begeisterung galt dem Reisen in weiteste Fernen, ebenso wie an schöne Plätze der österreichischen und ungarischen Heimat. Es war ihr vergönnt, im Urlaub im Salzkammergut inmitten ihrer Liebsten Abschied zu nehmen...“
Anna Geita, geb. Baranyai (23.8.1917), wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag unerwartet (7. August 2007) in ihrem Urlaubsort verstorben, war die Witwe des berühmten Sportklub-Stürmers der 30er-Jahre, Rudolf Geiter. Ihren Mann lernte sie bereits als 17-jährige kennen, ihre Familie betrieb damals das Hotel Jäger auf der Hernalser Hauptstraße.
Die Hochzeit fand am 9. März 1943 statt und es war einer kleinen Panne des Standesbeamten zu verdanken, dass die Eheleute einen fürderhin unterschiedlichen Familiennamen trugen.
Anna Geita erlebte den Werdegang des Wiener
Sportklubs - zuerst als Freundin und Gattin des Spielers, dann als Gattin
des Funktionärs Rudolf Geiter hinter den Kulissen mit und war später wie
kaum jemand anders in der Lage Anekdoten und kleine Geschichten aus diesen
Jahren zu erzählen. Aus der Ehe entstammen drei hervorragende Töchter, aber
leider- aus der Sicht des Wiener Sportklubs - kein Sohn. Dies war wohl der
einzige Grund, warum es nie einen Geiter II beim Wiener Sportklub gab. Nach
dem Tod ihres Gatten bleib Anna Geita mehr den je dem Wiener Sport-Club
treu. Mit ihr starb auch das älteste weibliche Mitglied.
Anna Geita gehörte zu den glücklichen Menschen, die bis zu ihrem Ende in
ihrer Familie geborgen blieben. Das Verhältnis zu ihren Töchtern zeichnete
sich durch eine beispielslose Innigkeit aus, das beweist auch die Geschichte
der letzten Wochen ihres Lebens. Noch im Juli 2007 war Anna Geita mit einer
ihrer Töchter für zwei Wochen auf Korfu gewesen, in der ersten August-Woche
ging es mit den Familien zweier ihrer Kinder zu einem weiteren Urlaub in die
Nähe von Bad Ischl. Eines Morgens fühlte sich Anna Geita schwach und wurde
von einem herbeigerufenem Arzt zur Erholung umgehend in das örtliche Spital
eingewiesen. Einen Tag nach der Einlieferung teilte man der Familie mit,
dass zwar keine akute Krankheit vorläge, aber die die zunehmende Schwäche
des hohen Alters die Lebensgeister schwinden ließen. An ihrem Krankenbett
versammelten sich innerhalb weniger Stunden nicht nur die drei Töchter
sondern auch sämtliche Enkel und die noch lebenden Schwiegersöhne. In diesem
wunderbaren Kreis der Geborgenheit schlief Anna Geita friedlich ohne Kampf
und Schmerz hinüber.
Andreas Pretschgo. Andreas Pretschgo (1808 - 1873), Pfarrer von Dornbach (1858 - 1863). Nach ihm wurde die Pretschgogasse (ex Andreasgasse) nahe der Vorortelinie benannt.

 Helene
Jäger. Frau Helene Jäger wurde am 25. Juli 1922 in Nikolsburg
geboren. Schon bald nach ihrer Geburt übersiedelte sie mit ihren Eltern nach
Znaim, wo sie zweisprachig aufwuchs. Im Jahr 1944 lernte sie ihren Mann
Toni, der in Znaim stationiert war, kennen. Sie heirateten noch im selben
Jahr. Ihre Tochter Helli wurde 1945 dort geboren. Sie führten 42 Jahre lang
eine besonders glückliche Ehe. Ihr gemeinsames Lebenswerk war das bereits
von Leopold Jäger 1911 gegründete Hotel Jäger in Hernals. 1986 starb - viel
zu früh - ihr geliebter Mann.
Helene
Jäger. Frau Helene Jäger wurde am 25. Juli 1922 in Nikolsburg
geboren. Schon bald nach ihrer Geburt übersiedelte sie mit ihren Eltern nach
Znaim, wo sie zweisprachig aufwuchs. Im Jahr 1944 lernte sie ihren Mann
Toni, der in Znaim stationiert war, kennen. Sie heirateten noch im selben
Jahr. Ihre Tochter Helli wurde 1945 dort geboren. Sie führten 42 Jahre lang
eine besonders glückliche Ehe. Ihr gemeinsames Lebenswerk war das bereits
von Leopold Jäger 1911 gegründete Hotel Jäger in Hernals. 1986 starb - viel
zu früh - ihr geliebter Mann.
In ihrem Leben spielten nur drei Dinge eine wichtige Rolle: ihre Familie
bestehend aus ihrem Mann Toni, ihrer Tochter Helli, Enkeltochter Andrea und
Urenkelin Christina, die ihr besonderer Stolz war, das Hotel Jäger und ihr
Haus am Kreuzberg.
In
den letzten Jahren, die sie trotz ihrer Krankheit zu Hause verbringen
durfte, galt ihre ganze Liebe ihrem „DREIMÄDERLHAUS“. Das Hotel Jäger war
für sie aber noch immer der Treffpunkt mit ihrem kleinen Freundes- und
Familienkreis.
Helene Jäger wurde am 1. April 2008 auf dem Hernalser Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Ein leises „Servus“ wurde ihr auf ihrem letzten Weg von Familie und Freunden mitgegeben.
Elisabeth Denkmair. Seit ich denken
kann, seit ich mich erinnere, kannte ich die Lux Elisabeth. Bereits als
Kleinkinder miteinander bekannt, besuchten wir gemeinsam in einer Klasse 4
Jahre die Volksschule in der Knollgasse. Wir erlebten als Volksschulkinder
schreckliche Kriegsjahre und entbehrungsreiche Nachkriegsjahre. Bis zuletzt
in Freundschaft verbunden erinnere ich mich an viele gemeinsame Erlebnisse.
Nun ist Elisabeth tot!
Elisabeth Lux war die älteste Tochter von Luise und Erwin Lux. Das
„Dreimäderlhaus“ Elisabeth-Maria-Gertrud - war in Dornbach ein Begriff.
Elisabeth wurde Lehrerin, war mit Dr. Hans Denkmair verheiratet und Mutter
eines Sohnes namens Christian. Nach dem Schuleintritt ihres Sohnes beendete
sie ihre Lehrtätigkeit, um ganz für die Familie da zu sein. Elisabeth war
ein kulturell interessierter und sozial engagierter Mensch. Ihre Liebe zur
Musik war bekannt, ihre regelmäßigen Besuche im Pensionistenheim Mauer und
bei Patienten im Haus der Barmherzigkeit zeigten hohe menschliche Qualität.
Elisabeth Denkmair hat so wie viele Menschen richtige und falsche
Entscheidungen getroffen, musste Enttäuschungen hinnehmen, Freud und Leid
erleben, Niederlagen verkraften, durfte Siege feiern und sich an Schönem
erfreuen.
Sie war ein gläubiger Mensch, der sich aber nicht kritiklos mit der Religion
und dem Pfarrleben auseinandergesetzt hat. (Nachruf: Robert Hysek)
Anna „Nossi“ Nossberger. Der Mädchenname "unserer Nossi" war Anna Maria Brunner. Schon als 18-Jährige übernahm sie durch den plötzlichen Tod ihrer Mutter bedingt das Wäschereigeschäft in der Dornbacherstraße. Dies wurde dann bis Sommer 2010 die Papierhandlung Nossberger. Durch die Verehelichung mit einem Nichtdornbacher aus dem Alsergrund wurde sie zur Frau Nossberger und bald überall in Dornbach als „Nossi“ bekannt. Es war unsere „Nossi mit dem Hut“ vor dem Geschäft sitzend. Sie war selten allein, fast immer fanden sich Gäste ein. Sie hatte ein offenes Ohr für Groß und Klein. Sie diente liebe- und humorvoll den Menschen, besonders den Kindern. Sie hatte eine sehr gute Menschenkenntnis. Nie hat sie ihr Anvertrautes weitererzählt.
 Kinder, Tiere und Dornbach waren die
drei Maximen ihres Lebens. Zahllos waren die Veranstaltungen, heute würde
man sie „Events“ nennen, die unter ihrer Mitwirkung das gesellschaftliche
und künstlerische Leben in Dornbach bereicherten. Ihr Organisationstalent,
gepaart mit der Kunst Leute zu motivieren, brachten es mit sich, dass viele
Künstler u.a. Frau Prof. Elfriede Ott, begeisterte Dornbachfans wurden.
Kinder, Tiere und Dornbach waren die
drei Maximen ihres Lebens. Zahllos waren die Veranstaltungen, heute würde
man sie „Events“ nennen, die unter ihrer Mitwirkung das gesellschaftliche
und künstlerische Leben in Dornbach bereicherten. Ihr Organisationstalent,
gepaart mit der Kunst Leute zu motivieren, brachten es mit sich, dass viele
Künstler u.a. Frau Prof. Elfriede Ott, begeisterte Dornbachfans wurden.
Als Pfarrgemeinderätin war sie lange Zeit für das Pfarrblatt „Begegnung“ verantwortlich. In dieser Zeit sammelte sie Spenden für die Renovierung der Annakapelle, der Pfarrkirche und für die Muttergottesstatue von Prof. Huber am Himmelmutterweg.
Eine ihrer ganz großen Freuden war ein Tag bei Kardinal König im Rahmen einer Aktion von „Thema Kirche“. Von Kardinal König und P. Benno sprach sie immer wieder.
Sie gründete den „Verein zur Erhaltung des Ortsbildes von Dornbach und Neuwaldegg“ und setzte sich sehr dafür ein. Ohne Nossi wären auch die wunderbaren Bücher „Geliebtes Dornbach“ und „Es war einmal“ sicher nicht entstanden, deren Inhalt Herr Mag. Theodor Nossberger verfasste. Dornbacher und Neuwaldegger erinnern sich mit Freude daran. Zuletzt rief sie noch die immer mehr geschätzte jährliche Veranstaltung „Montmartre in Dornbach“ ins Leben. Als Lohn für ihr soziales Engagement bekam sie den Du&Ich Preis, gestiftet von der Bezirksvorsteherin Dr. Ilse Pfeffer.
Als Geschäftsfrau war Nossi auch ein Aushängeschild der Dornbacher Kaufleute. Zahlreiche Grätzelfeste, Modeschauen und Adventmärkte in der Waldschnepfe sollten das Geschäftsleben in Dornbach neu beleben.
Aufgrund ihres immer schlechter werdenden Gesundheitszustandes war es notwendig geworden, sie in die Krankenanstalt "Göttlicher Heiland" zu bringen. Von ihrer Krankheit gezeichnet, hatte sie noch immer viele Pläne für Dornbach und war von der Rückkehr in ihr Geschäft überzeugt.
Nach einem kurzen Aufenthalt zuhause wurde sie in das Wilhelminenspital gebracht, wo sie liebevoll gepflegt und von einer Mitpatientin, die für sie betete, und von ihrem Mann begleitet, friedlich sterben durfte. (Nach einem Nachruf von Mag. Theodor Nossberger & Eveline Högl)